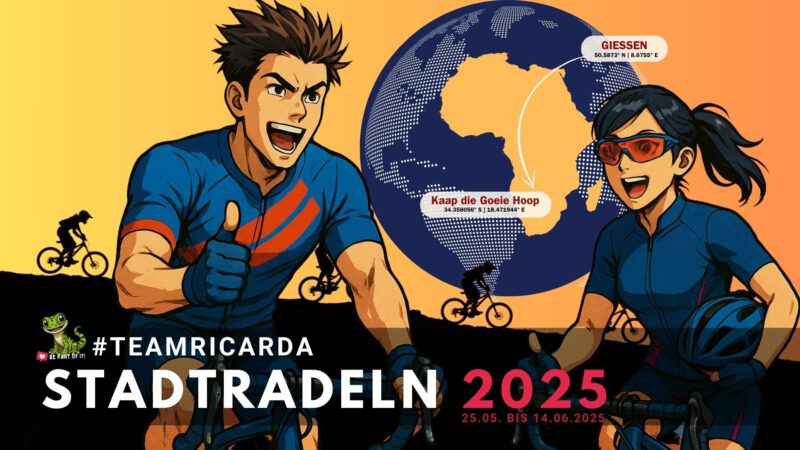Ein Textimpuls >>>>>
FRANZ KAFKA
Heimkehr
Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. Die Pfütze in der Mitte. Altes, unbrauchbares Gerät, ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind. Ich bin angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, teils niemals kannte. Was kann ich ihnen nützen, was bin ich ihnen und sei ich auch des Vaters, des alten Landwirts Sohn. Und ich wage nicht an die Küchentür zu klopfen, nur von der Ferne horche ich, stehend, nicht so, dass ich als Horcher überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne horche, erhorche ich nichts, nur einen leichten Uhrenschlag höre ich oder glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber aus den Kindertagen. Was sonst in der Küche geschieht, ist das Geheimnis der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren. Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn jetzt jemand die Tür öffnete und mich etwas fragte. Wäre ich dann nicht selbst wie einer, der sein Geheimnis wahren will.
Nicht das „Heimkommen“ im klassischen Sinn spielen, sondern die Verunsicherung, das Zögern, die Leere körperlich und klanglich erfahrbar machen.
Postdramatische Bausteine für die Inszenierungsarbeit
Text als Material
Baustein: Lest den Text nicht als Geschichte, sondern als Rohstoff. Schneidet ihn in Sätze oder Wörter. Jeder wählt spontan einen Satz, den er/sie mehrmals wiederholt – flüsternd, laut, abgehackt.
Konzept dahinter: Postdramatisches Theater trennt Text von Handlung. Sprache ist Klang, Rhythmus, Bild.
Chorische Verfahren
Baustein: Alle sprechen „Ich bin zurückgekehrt“ gleichzeitig. Dann sprechen sie zeitversetzt wie ein Echo, dann fragmentiert (nur einzelne Wörter).
Konzept dahinter: Chorische Sprache schafft Atmosphäre und löst Individualität auf.
Körper statt Figur
Baustein: Übersetzt einen Satz in eine Bewegung oder Pose. Wiederholt die Bewegung in Variationen (sehr langsam, abrupt, grotesk).
Konzept dahinter: Nicht „Rollen spielen“, sondern Körper als Ausdrucksmittel.
Raum- und Ding-Experimente
Baustein: Stellt Objekte (z. B. Stühle, ein Tuch, einen Eimer) im Raum auf. Jede/r wird ein Objekt (die Pfütze, das Tuch, die Katze). Der „Ankommende“ bewegt sich vorsichtig durch diesen Raum.
Konzept dahinter: Der Raum selbst ist „Spieler“. Dinge und Bilder sind gleichwertig mit Text.
Soundcollage
Baustein: Erarbeitet aus einem Satzfragment (z. B. „Wer wird mich empfangen?“) eine Art Klangcollage.
Konzept dahinter: Sprache muss nicht Sinn ergeben – sie kann Atmosphäre erzeugen wie Musik.
Bühnenbild als Installation
Baustein: Statt einer realistischen „Wohnküche“ entsteht eine abstrakte Installation (z. B. ein Raum voller Stühle, die Rücken an Rücken stehen, oder verstreute Alltagsobjekte, die keinen Zusammenhang ergeben).
Konzept dahinter: Bühne als Bild, nicht als Nachbau einer Realität.
Musikalische Verfremdung
Baustein: Unterlegt das Sprechen des Textes mit unpassender Musik (z. B. fröhlicher Pop-Song, der die Kälte des Textes bricht). Danach mit düsterem Soundteppich (Brummen, Dröhnen, Herzschlag).
Konzept dahinter: Musik lenkt Wahrnehmung und kann Kontraste erzeugen.
Licht als Mitspieler
Baustein: Ein Satz wird nur im Dunkeln gesprochen, dann wieder unter grellem Licht. Eine Taschenlampe wird als „Blick“ benutzt, der auf Dinge oder Spieler:innen zoomt.
Konzept dahinter: Licht schafft Atmosphäre und Hierarchie, kann Intimität oder Kälte herstellen.
Medienprojektion
Baustein: Wörter aus dem Text („Heimkehr“, „Geheimnis“, „Unsicherheit“) werden an die Wand projiziert. Gleichzeitig bewegen sich die Spieler:innen davor, sodass ihre Körper die Schrift teilweise verdecken.
Konzept dahinter: Medien erweitern den Raum und verschieben den Fokus vom Schauspieler zum Bild.
Live-Kamera
Baustein: Eine kleine Kamera filmt, wie jemand ganz nah an eine „Tür“ lauscht oder an einem Tisch sitzt. Das Bild wird vergrößert an die Wand projiziert.
Konzept dahinter: Nahaufnahme und Projektion brechen die Distanz und erzeugen ein „Übersehenwerden“.
Objekt als Partner
Baustein: Ein Stuhl oder Eimer wird wie eine Figur behandelt: man spricht mit ihm, umkreist ihn, wagt nicht, ihn zu berühren.
Konzept dahinter: Dinge können Figurenstatus haben – Kafka-Atmosphäre entsteht durch eine Welt der Dinge.
Schweigen und Pausen
Baustein: Spielt eine Szene, in der 30 Sekunden lang niemand spricht, nur die Körper reagieren (horchen, stocken, erstarren). Dann bricht plötzlich ein Satz hervor.
Konzept dahinter: Pausen und Schweigen sind gleichwertig zu Sprache.
Verfremdung durch Bewegungschor
Baustein: Alle machen dieselbe Bewegung (z. B. das vorsichtige Heben der Hand zum Klopfen) – aber in unterschiedlichem Tempo, bis ein Bewegungschaos entsteht.
Konzept dahinter: Chorisches Arbeiten betont Strukturen und Muster statt individueller Figuren.
Alltagsgeräusch als Soundtrack
Baustein: Eine Gruppe erzeugt im Hintergrund Alltagsgeräusche (Tellerklappern, Uhrticken, Besteckklirren). Der Text wird darüber gesprochen.
Konzept dahinter Das Banale wird bedrohlich, wenn es in den Vordergrund rückt.
Kostüm als Marker
Baustein: Statt Kostümen nur Marker: z. B. alle in Schwarz, und jeder, der spricht, zieht sich ein rotes Band um den Arm.
Konzept dahinter: Kostüme müssen nicht realistisch sein – kleine Marker erzeugen Symbolik.